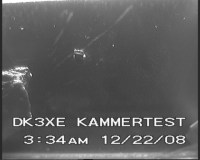Wer Tippfehler findet, darf sie gern behalten. Ich schreibe generell OHNE elektronische Rechtschreibprüfung.
Die Grundlagen sind ja nun geschaffen und ich musste diese Apparatur "nur" noch zum Nebelmachen bringen. Die Temperatur reichte mit ca. -8°C nicht aus. Mehr gaben die Peltier-Elemente in dieser Anordnung nicht her.
An dieser Stelle kann ich vorerst nicht weiter schreiben. Vor einiger Zeit fand ich im Netz einen Beitrag von einem Schüler, der etliche Versuche zur Optimierung der Anordnung der Peltier-Elemente gemacht hat. Das war für mich der Anstoß, diese Versuche zu wiederholen und somit meine Kammer zum Funktionieren zu bringen. Ich möchte auf jeden Fall auf diesen Beitrag verweisen, finde den Link jedoch nicht. Ich suche derzeit intensiv. Wenn ich den Link gefunden habe, gehts hier weiter....
25.12.2008 02:40:00
So, nu aber! :-)
Eines gleich vorweg: Nicht dass hier jemand auf dumme Gedanken kommt und mir eventuell etwas unterstellen will! Ich verwende hier nur Quellen aus natürlichen Mineralien. Solche Mineralien sind in Mineralienhandlungen zu bekommen oder aber in diversen alten Steinbrüchen oder auf alten Abraumhalden zu finden. Trotz dieser Natürlichkeit müssen solche Mineralien mit entsprechender Vorsicht gehandhabt und gelagert werden! Ich werde demnächst auf einer Extraseite darauf eingehen und einige dieser Mineralien vorstellen. Bitte etwas Geduld, ich arbeite daran.
Um mit Peltierelementen in der Kammer eine brauchbare Temperatur (<-18°C) zu erzeugen, müssen die Elemente thermisch sinnvoll angebracht werden. Darauf wies mich schon Jörg, DL3NRV hin (vielen Dank nochmals). Bei ganz kleinen Kammern kommt man wohl mit einem Element aus. In meinem Fall war das nicht mehr machbar, wie die vorherigen Versuche zeigten. Christian Plötzing hat in einer Abhandlung (das war der von mir gesuchte Link) dazu mehrere Versuche beschrieben und eine optimale Anordnung der Elemente ermittelt. Diese Versuche habe ich wiederholt und bin zu den selben Ergebnissen gekommen.
Unterhalb der Kammerkühlplatte habe ich ein Element positioniert. Darunter eine Alu-Platte von 2mm Stärke und den Abmessungen (etwa) 90 x 50mm. Darunter wiederum 2 weitere Peltier-Elemente nebeneinander und elektrisch parallel geschaltet. Das Ganze sitzt dann auf dem Wasserkühler auf. Das obere Element betreibe ich mit 4,0V und die beiden unteren mit jeweils 7,8V. Wohlgemerkt: Es handelt sich hier um 12V-Elemente! Diese Einstellungen haben sich für meine Anordnung und die von mir verwendeten Elemente als optimal erwiesen und ich erreiche so gute -20°C. Für Peltier-Elemente anderer Hersteller können sich durchaus auch andere optimale Spannungswerte ergeben. Das muss in jedem Fall experimentell ermittel werden und gann gut und gerne mehrere Stunden in Anspruch nehmen. Die ganze Apparatur ist sehr träge.
|
Der vordere Anschluss mit der Krokoklemme ist für die
Hochspannung der Ionenfalle. |
Hier sieht man die Anordnung der gestapelten Elemente samt Kammer und
Wasserkühler. |
Die Problematik mit dem Verdampfer habe ich für diesen Versuch nun wirklich amatuerhaft gelöst. Der kammerraum wird mit einem Blechdeckel abgedeckt - er liegt nur lose auf. An der Unterseite habe ich mit Draht einen Filzstreifen befestigt und an der Oberseite zwei dicke Widerstände mit je 3,3Ω in Reihe. Der Deckel bleibt nach dem Einschalten der Kammer so lange drauf bis die -20°C erreicht sind. Erst dann nehme ich ihn kurz(!!) ab um den Filz mit 15ml Ethanol zu tränken. Deckel wieder drauf, und nun schalte ich die Widerstände mit gut 1A zu um den Verdampfungsvorgang und den Aufbau des Temperaturgefälles in der Kammer zu beschleunigen. Nach etwa 5 Minuten können die Widerstände abgeschaltet werden. Es sollte sich dann ein recht stabiler Nebel auf der Kühlplatte abzeichnen. Die Menge des verdampften Alkohols hängt vom Kammervolumen ab. Bei größeren Kammern kann es durchaus nötig sein, die Verdampfung kontinuierlich elekrtisch zu unterstützen.
|
|
|
Auf den folgenden Bildern ist der Gesamtaufbau zu sehen. Ja, ich weiss, das hat alles wieder mal provisorischen Charakter. Aber ich will die Kammer auch nicht ewig betreiben, zumal die Variante mit dem Kryostaten nun wirklich nicht optimal ist. Dieser ließ sich leider nicht für diese Versuche umfunktionieren, so dass ich auf die Peltie-Elemente hätte verzichten können. Das eigentliche Aggregat bringt nicht genügend Druck um -20°C zu erreichen. Also musste ich diesen Umweg wählen. Die Temperatur des Kühlwassers beträgt im Betrieb konstant +2,7°C und wird ständig dürch den Wasserkühler gepumpt. Die Beleuchtung erfolgt wieder mit einer LED-Zeile von Reichelt-Elektronik.
|
|
|
Am oberen Rand des Acrylglasaufsatzes habe ich die Drähte für die Ionenfalle angebracht. Der Draht besteht aus 0.12mm CuL und wird , von einem Ende beginnend, in einem Stück eingefädelt. Nur in der Mitte bleibt ein Segment frei um etwas mehr Platz zum Einbringen von Proben in den Kammerraum zu haben. Dazu muss die Hochspannung abgeschaltet werden, da sonst die akute Gefahr einer Verpuffung besteht! Schließlich ist der Kammerraum im Betrieb mit Alkoholdämpfen gefüllt. Vor dem Zuschalten der Hochspannung ist diese auf Null zu drehen. Erst dann darf eingeschaltet und die Hochspannung langsam auf den Sollwert erhöht werden. Als Hochspannungsquelle verwende ich ein Labornetzgerät mit regelbarer Hochspannung von 0 bis 6kV und einigen wenigen Milliampere. In die Plus-Leitung habe ich einen stabilen 10MΩ-Widerstand eingefügt. Allerdings habe ich im Betrieb bei 3kV keine Wirkung dieser Ionenfalle bemerkt/feststellen können. Warum das so ist, weiß ich noch nicht.
|
|
|
Und hier nun einige
Aufnahmen aus der Nebelkammer. Ethanol 70% bei -18°C.
Und erst unterhalb von -18°C beginnt die Kammer zu funktionieren!
Und erst unterhalb von -18°C beginnt die Kammer zu funktionieren!
|
Links eine
Uran-Probe, rechts
eine Thorium-Probe |
|
Hier verwende ich ein Stück Pechblende als Quelle. Diese werde ich auf einer gesonderten Seite beschreiben. Die Aufnahmen wurden per SnapShot mit einer Videokamera und PC gemacht.
Isopropanol 99,96% bei -20°C.
Und hier gibts noch ein paar kleine Video-Clips zu sehen...
| Clip 1 | Clip 2 | Clip 3 | Clip 4 |
| Clip 5 | Clip 6 | Clip 7 | Clip 8 |
Ob und wie sich ein Unterschied zwischen
Ethanol 70% und Isopropanol 99,96% auswirkt, werde ich in nächsten
Versuchen ermitteln und hier beschreiben.
03.01.2009
Zum vorläufigen Abschluss...
Ich konnte bei weiteren Experimenten keinen Unterschied zwischen Isopropanol 99,96% und Ethanol 70% feststellen. Mag sein, dass sich ein Unterschied erst bei einem größeren Kammervolumen einstellt. Der passive Verdampfer hat völlig ausgereicht. Ein höherer Aufwand dürfte sich hier erst bei einer größeren Kammer wirklich lohnen. Auf einen geschlossenen Alkoholkreislauf verzichtete ich. Den Filz habe ich mit ca. 15 - 20ml Ethanol getränkt. Das reicht locker für den Betrieb über mehrere Stunden hinweg. Auch bei der Ionenfalle mit 3000V ist mir kein Einfluss auf die Funktion der Kammer aufgefallen. Die Nebelspuren waren mit und ohne Hochspannung sehr gut sichtbar.
Erst bei < -18°C beginnt die Kammer zu arbeiten. Die Einstellung der Peltier-Elemente habe ich so weit getrimmt, dass ich jetzt ohne Probleme -23°C erreiche. Der Kryostat hat sich bestens bewährt und der Wasserkühler ebenfalls. Allerdings ist vollständig aushärtender EPOX nicht geeignet. Es bilden sich nach einiger Zeit Haarrisse zw. Kühlkörper und Kunststoffgehäuse und geringe Mengen an Wasser treten aus. Hier wäre ein EPOX mit einer geringen Elastizität besser geeignet um die Temperatur- und Ausdehnungsdifferenzen unterschiedlicher Materialien besser zu kompensieren.
Der große Wasserauffangbehälter unter der Kammer hat sich bewährt. Im Normalbetrieb bildet sich an der Unterseite der Kammer reichlich Eis, welches nach Abschalten der Kammer gut abtropfen kann. Auch die erwähnte Undichtigkeit stellte somit kein Problem dar. Im Ernstfall hätte der Behälter die gesamte Wassermenge des Kryostaten aufnehmen können. In einem weiteren Versuch hätte man noch die Seitenwände und die Unterseite der Kammer mit Styropor isolieren können. Darauf habe ich aber verzichtet.
Ich habe gesehen was ich sehen wollte und nun die Kammer erstmal wieder abgebaut. Sollte ich doch nochmal ein richtiges Kühlaggregat bekommen, kann ich mir gut vorstellen, noch eine große und dauerhafte Version der Kammer zu bauen.
War jedenfalls mal ein netter Spaß. :-)
Zurück
Falls Sie von einer anderen Internetseite gekommen sind, hier geht´s zu meiner Startseite